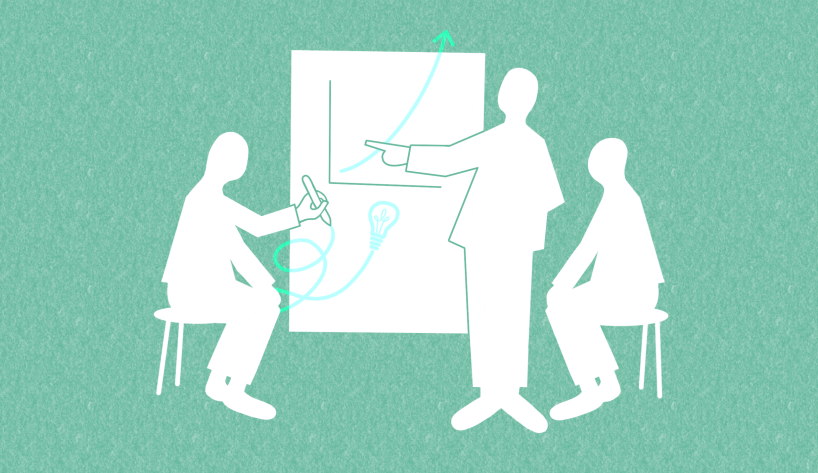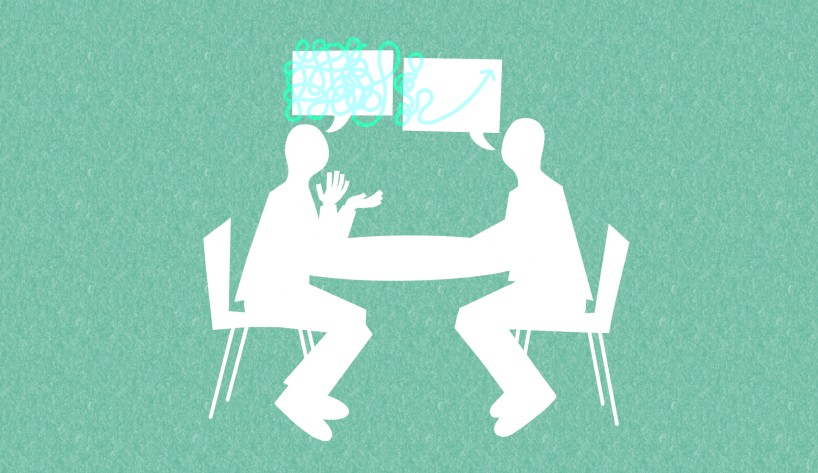Der Kanton anerkennt und schätzt die wichtige gesellschaftliche Rolle der verschiedenen Religionsgemeinschaften. In diesem Sinne sollen Menschen in unserem Kanton ihren Glauben in einem sicheren Umfeld leben und feiern können. Der Kompass zur Prävention von sexuellem Missbrauch und Machtmissbrauch im religiösen Kontext soll dazu beitragen, dass religiöse und staatliche Stellen ihrer Verantwortung gegenüber rat- und hilfesuchenden Menschen gerecht werden.
Der Kompass wurde im Rahmen der St.Galler Konferenz zu Fragen von Religion und Staat erarbeitet. Er dient als gemeinsamer Orientierungsrahmen für die Prävention von Grenzverletzungen und Machtmissbrauch, insbesondere in Form von psychischer und sexueller Gewalt, im religiösen Kontext. Der Kompass soll als Ausgangspunkt für die Präventionsbemühungen und damit verbundene Entwicklungsprozesse in den einzelnen Religionsgemeinschaften dienen.
Das Ziel ist es, durch eine gemeinsame Haltung die Zusammenarbeit und Vernetzung in der Prävention unter den Religionsgemeinschaften zu fördern. Dabei werden auch die Handlungsfelder Intervention und Nachsorge/Aufbereitung in den Blick genommen. Neben religiösen Organisationen kann der Kompass auch für die interessierte Öffentlichkeit sowie für die Betroffenen von Machtmissbrauch eine Orientierungshilfe darstellen.
Den an diesem Kompass Beteiligten ist bewusst, dass sich die Religionsgemeinschaften stark unterscheiden, auch was die Grösse, Strukturen und Ressourcen betrifft. Deshalb wird es nicht allen gleichermassen möglich sein, sämtliche Aspekte des Kompasses in der gleichen Detailliertheit und zeitnah umzusetzen. Der Kompass gibt aber allen Beteiligten eine klare Richtung bezüglich Haltung und künftigen Entwicklungen vor. Im Kompass finden sich aktuelle Links zu weitergehenden Informationen, Unterlagen, Weiterbildungen und Veranstaltungen – mit dem Ziel, dass Religionsgemeinschaften sich in diesen Fragen vernetzen und voneinander lernen.
Im Folgenden sind konkrete Leitsätze und Massnahmen seitens der Religionsgemeinschaften («wir») formuliert, welche diese in der Praxis umsetzen können. Diese beziehen sich auf drei Handlungsfelder der Prävention sowie auf Intervention und Aufarbeitung. Diese Felder stellen zugleich zentrale Elemente eines umfassenden Schutzkonzepts einer Organisation dar.
Prävention
Aus- und Weiterbildung
- Wir setzen uns dafür ein, dass die Prävention von Machtmissbrauch bereits in der Ausbildung der Mitarbeitenden angemessen verankert ist.
- Wir organisieren regelmässige Weiterbildungsangebote und verbindliche Schulungen für Leitungspersonen, Angestellte und Freiwilligenverantwortliche zur Thematik. Wir können dafür auch auf die Erfahrung und die fachlichen Kompetenzen der öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften zurückgreifen.
- Wir organisieren regelmässig öffentliche Sensibilisierungsveranstaltungen, Vortragsabende usw. für Freiwillige, Engagierte und Interessierte in unserer Religionsgemeinschaft.
Insbesondere bei sexueller Gewalt im institutionellen Kontext handelt es sich um strategisch geplante Taten. Abhängigkeitsverhältnisse werden ausgenutzt, das Opfer und das Umfeld systematisch manipuliert. Schlüsselpersonen der Organisation sollen die Dynamiken von Macht und Machtmissbrauch verstehen, Haltungen reflektieren und Empathie entwickeln können. Dazu braucht es verankerte und wiederkehrende Aus- und Weiterbildungsangebote für Leitungspersonen wie für Angestellte und nicht zuletzt auch für freiwillig Engagierte, die direkt mit Menschen arbeiten. Es geht darum, Grundwissen zu vermitteln, Ängste und Verunsicherung in der Thematik abzubauen und so eine neue Vertrauensbasis und Sicherheit zu bieten. Das gelingt durch eine Fehler- und Feedbackkultur, die es ermöglicht, heikle Situationen im nicht strafrechtlich relevanten Bereich besprechbar zu machen. Ziel ist es, gemeinsam zu einer lernenden Organisation zu werden, die bereit ist, sich weiterzuentwickeln.
Risikomanagement
- Wir kennen die wichtigsten Risikosituationen in unserer Religionsgemeinschaft. Wir schaffen Strukturen und Standards für einen transparenten und verantwortungsvollen Umgang von Religionsvertretenden und Leitungspersonen mit Macht sowie für ein professionelles Verhalten in Risikosituationen zum Schutze aller.
- Wir fördern eine Kultur in der solche Situationen besprochen werden können, indem wir aktiv kritisches Feedback (z.B. von Kolleginnen und Kollegen) einholen und Irritationen in Risikosituationen ansprechen.
- Wir legen Qualitätsstandards in einem verbindlichen Verhaltenskodex fest und machen damit verborgene Risiken und Machtkonstellationen sichtbar und besprechbar.
Jede Organisation, die für und mit Menschen arbeitet und sich für Menschen einsetzt, hat allgemeine und spezifische Risiken. Da wo Beziehungen gestaltet und gelebt werden, passieren «Fehler» und es kann zu Grenzverletzungen kommen. Menschen, die sich, in ihrer Sinnsuche, mit ihrem Bedürfnis nach Halt und Orientierung, oder in emotional belastenden und in Notsituationen an Vertretende einer Religion wenden, haben ein Recht darauf, dass ihre Integrität entsprechend geschützt ist. In der Arbeit mit rat- und hilfesuchenden Menschen, sowie mit Minderjährigen besteht ein besonders starkes Machtgefälle. Die Tatsache, dass Religionsvertreternde gegenüber der rat- und hilfesuchenden Person in der mächtigeren Position ist, lässt sich kaum beeinflussen, der Umgang mit solchen Situationen jedoch schon. Sie bedingen ein hohes Mass an Sorgfalt, Rollenklarheit und Professionalität. Dadurch können die Risiken für Machtmissbrauch stark gesenkt werden. Im Kern geht es darum, konkrete Risikosituationen zu benennen, Verantwortliche innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft dafür zu sensibilisieren und Standards für adäquates professionelles Verhalten festzulegen.
Personalführung
- Wir wählen das Personal, das insbesondere mit Minderjährigen und weiteren vulnerablen Personengruppen arbeitet, sehr sorgfältig aus.
- Wir verlangen von allen Bewerbenden einen Privat- und einen Sonderprivatauszug aus dem Strafregister und bestehen darauf, mindestens eine Referenz von der letzten Arbeitsstelle zu erhalten. Mögliche Vorkommnisse im Zusammenhang mit grenzverletzendem Verhalten (Nähe und Distanz) oder strafbaren Handlungen werden dabei explizit nachgefragt.
- Wir schulen und unterstützen die Mitarbeitenden mit Personalverantwortung im Umgang mit Grenzverletzungen im nicht strafrechtlichen Bereich.
Prävention ist in hohem Masse Führungsaufgabe. Die Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitenden gilt es dabei ebenso wahrzunehmen wie den Schutz der Menschen, die sich uns anvertrauen. Es bewährt sich, entsprechende Massnahmen im gesamten Personalmanagement zu verankern, von der Ausbildung über die Rekrutierung und Personalführung, bis zur Auflösung von Anstellungs- und Auftragsverhältnissen. Intransparente Abweichungen von vereinbarten Qualitätsstandards oder Grenzverletzungen unterhalb des strafbaren Bereichs gilt es zeitnah in Führungsgesprächen zu thematisieren und zu dokumentieren. Da solche Gespräche sowie die Durchsetzung von Massnahmen und Auflagen sehr anspruchsvoll sein können, benötigen Leitungspersonen und Teamverantwortliche entsprechend Unterstützung.
Intervention: Opferberatung, Meldestellen, Fallbearbeitung
- Wir ermöglichen ein angstfreies Klima und einen geschützten Raum für Meldungen in Form einer internen und/oder externen Meldestelle mit niederschwelligem Zugang.
- Wir kennen die Angebote der unabhängigen Opferhilfe SG-AR-AI und informieren unsere Mitglieder proaktiv darüber. Betroffene, die sich bei uns melden, weisen wir konsequent auf dieses Angebot und auf die Möglichkeit einer Anzeige bei der Polizei hin.
- Wir sorgen dafür, dass die Aufgaben der Meldestelle, die Abläufe nach einer Meldung, die Verantwortlichkeiten in der Fallbearbeitung und Fallführung, sowie die Zusammensetzung und Funktion eines Krisenstabs in einem Interventionskonzept verbindlich geregelt und allen Verantwortlichen bekannt sind.
Der Verdacht auf eine Sexualstraftat durch eine Meldung markiert in der Regel den Beginn einer Krisensituation für eine Organisation. Hier braucht es Ruhe und wohl überlegtes, besonnenes Handeln nach einem klaren Interventionsplan mit klar beschriebenen Verantwortlichkeiten. Es gilt, Ungewissheiten auszuhalten, zeitnah und doch sorgfältig zu agieren, sowie folgenschwere Entscheidungen zu treffen. Dabei gilt es mögliche Opfer und weitere vulnerable Personen angemessen zu schützen, auf das Angebot der Opferhilfe hinzuweisen und zugleich die Persönlichkeitsrechte einer beschuldigten Person zu wahren. Das gelingt kaum ohne rechtzeitigen Einbezug von unabhängiger fachlicher Unterstützung und Beratung, insbesondere aus den Bereichen Arbeits- und Strafrecht, Psychologie und Krisenkommunikation. Es bewährt sich, Abläufe und Zuständigkeiten vorgängig zu klären und in einem Kriseninterventionskonzept festzuhalten.
Nachsorge und Aufarbeitung als Aufgaben der eigenen Institution
- Wir nehmen die Erfahrung und das Leid Betroffener ernst. Wir sind entschlossen, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen und uns, unter Einbezug der Betroffenenperspektive, als lernende Organisation weiterzuentwickeln.
- Wir schaffen die Voraussetzungen für eine achtsame Aufarbeitungs- und Nachsorgekultur. Diese ist Teil unseres Schutzkonzepts und regelmässig Thema bei Weiterbildungen für Führungspersonen.
- Wir setzen uns bei Vorfällen von sexueller Gewalt für eine lückenlose Aufklärung und für Transparenz in der Öffentlichkeitsarbeit ein, unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte Betroffener und Beschuldigter.
Im Anschluss an die eigentliche Fallbearbeitung durch die Justiz und die Organisation stellen sich herausfordernde Fragen: Wie nach Vorfällen in traumatisierten Organisationen Raum schaffen? Wie Trauer, Wut, Scham und Schuldgefühle im professionellen Kontext bewältigen? Wie gemeinsam nach der emotionalen Entlastung reflexiv zurück und dann nach vorne schauen? Für die Opfer, sowie für ein mitbetroffenes Team oder eine Gemeinde ist ein Fall nicht einfach abgeschlossen, selbst dann nicht, wenn eine Tatperson aus dem Verkehr gezogen oder verurteilt wurde. Hier ist ein empathischer Umgang mit Betroffenen und Support für Mitbetroffene Personen ebenso gefragt, wie ein kritischer Blick auf die eigene Organisation. Zudem gelingt Aufarbeitung kaum ohne achtsamen Einbezug von Betroffenen und ohne fachliche Unterstützung von aussen für einen solchen Prozess.
Im religiösen Kontext beginnt Machtmissbrauch oft als eine besondere Form von emotionaler Manipulation und psychischer Gewalt, indem religiöse Gefühle, Erzählungen oder Autoritäten dafür instrumentalisiert werden. Dadurch wird die spirituelle Autonomie einer Person eingeschränkt, mit dem Ergebnis der spirituellen Not und der umfassenden Verwundbarkeit der begleiteten Person (Doris Wagner 2019[1]). Der Name Gottes oder der Glaube an das Göttliche wird missbraucht, um Macht über Menschen zu gewinnen. Stimmen der Religionsvorsteher/-innen werden mit der Stimme Gottes verwechselt (Klaus Mertes 2019[2]). Ein solches Verhalten ist mit der Manipulation, Unterdrückung und Ausnutzung anderer im Namen Gottes verbunden, um sie für das Erreichen eigener Zwecke und Ziele gefügig zu machen. Dies geschieht durch ungesunde emotionale Abhängigkeiten und mentale Manipulationen, bei denen Lehren, Werte und Begriffe entstellt werden, um sie zur Untermauerung von Machtansprüchen einzusetzen (Hannah A. Schulz 2019[3]). Solche Formen des Missbrauchs religiöser Autorität sind oft ein wesentlicher Aspekt in der Vorbereitung von Sexualstraftaten gegenüber Minderjährigen und Erwachsenen im religiösen Kontext (Grooming-Strategie).
[1] Doris Wagner, Spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche, 2. Aufl., Herder 2019.
[2] Klaus Mertes, Geistlicher Missbrauch – theologische Anmerkungen, in: Stimmen der Zeit 2019/2, S. 93-102
[3] Hannah A. Schulz, Perfide Konstrukte – Was ist geistlicher Missbrauch, in: Herder Korrespondenz 10/2019, 73. Jg., S .36-38.
Grenzverletzungen und strafbare Handlungen innerhalb von religiösen Abhängigkeitsverhältnissen sind in der Regel durch den Missbrauch institutioneller und persönlicher Macht geprägt (siehe Definition Religiöser Machtmissbrauch). Deshalb wird Machtmissbrauch hier als Überbegriff verwendet. Prävention beginnt mit einem kritischen Blick auf die eigenen Strukturen, auf Machtkonstellationen und Abhängigkeitsverhältnisse, sowie auf spezifische Risikosituationen in den unterschiedlichen religiösen Tätigkeiten und Angeboten.
Veranstaltungen:
- 8. September 2025, Paulus Akademie Zürich, Grenzen des Heiligen | Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz neues Fenster
- 11. September 2025, Paulus Akademie Zürich, Gemeinsam gegen Missbrauch, Ökumenische Perspektiven für wirksame Schutzkonzepte. neues Fenster
Vergangene Veranstaltungen:
- 4. Juni 2025, Tagung Machtmissbrauch im religiösen Kontext, St.Galler Konferenz zu Fragen von Religion und Staat, Link zur Tagung-Website. neues Fenster
- 16. Mai 2025, Konferenz "Wie kann Prävention, Intervention und Aufarbeitung von sexualisiertem und spirituellem Machtmissbrauch in den Evangelisch-reformierten Kirchen gelingen?", femmes protestantes, Download neues Fenster Ergebnisse der Konferenz
Anlaufstellen und unabhängige Opferberatung für Betroffene
- Opferhilfe Schweiz: http://www.opferhilfe-schweiz.ch neues Fenster
- Deutschschweiz: Interessengemeinschaft für Missbrauchsbetroffene im kirchlichen Umfeld (IG-M!kU), Home | IG-M!kU neues Fenster
- Französischsprachige Schweiz: Soutien aux personnes abusées par des prêtres de l’Eglise catholique SAPEC neues Fenster, Gruppo di ascolto per vittime di abusi in ambito religioso GAVA neues Fenster)
- Italienischsprachige Schweiz: Gruppo di ascolto per vittime di abusi in ambito religioso GAVA neues Fenster)
- Selbsthilfegruppe St.Gallen und Appenzell: Home | Selbsthilfe St. Gallen neues Fenster
- Selbsthilfe Schweiz: Selbsthilfegruppen in der Schweiz finden – Unterstützung & Austausch neues Fenster
Aufarbeitung
Noch offene Fragen?
Chompel Balok
Stv. Generalsekretär
Kanton St.Gallen Departement des Innern
Generalsekretariat
Klosterhof 3
9001 St.Gallen