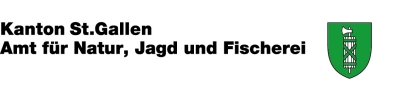Amt für Natur, Jagd und Fischerei
Neues aus unserem Amt
Newsletter ANJF 2025-02

Die Natur ist in Bewegung – und mit ihr entwickelt sich auch unsere Arbeit weiter. In dieser Ausgabe zeigen wir, was sich aktuell im Amt für Natur, Jagd und Fischerei tut und wie vielfältig unsere Themen sind.
Wir tauchen ein in die faszinierende Welt der Quell-Lebensräume, die zu den kleinsten, aber ökologisch wertvollsten Lebensräumen gehören. Zudem stellen wir die überarbeitete Wegleitung zu den Schutzverordnungen vor, die Gemeinden und Planungsbüros dabei unterstützt, Landschaften und Lebensräume effizient und rechtssicher zu schützen.
Im Bereich Fischerei steht das neue Bewirtschaftungskonzept Fischerei 2025–2032 im Mittelpunkt – mit klaren Zielen für eine nachhaltige Nutzung und den Schutz unserer Gewässer. Gleichzeitig erleichtert die neue eFJ-App den Bezug von Fischereipatenten – digital, einfach und rund um die Uhr.
Auch personell gibt es Neues: Dr. David Frei verstärkt unser Team als Fachspezialist Fischerei und Stellvertreter von Christoph Birrer. Mit seiner Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Forschung, Praxis und Verwaltung bringt er frischen Wind und wertvolle Expertise ins Amt.
Und schliesslich richten wir den Blick auf zwei faszinierende Wildtiere unserer Alpenwelt: Das aktuelle Luchsmonitoring zeigt stabile Bestände in der Nordostschweiz, während eine neue Studie zur Ernährung des Wolfs spannende Einblicke in dessen Jagdverhalten liefert.
All das und mehr finden Sie in dieser Ausgabe – spannend, informativ und nah dran an der Natur des Kantons St.Gallen.
ABTEILUNG FISCHEREI

Eine App für clevere Fischer/innen
.jpg)
Auf den 1. Januar 2026 stellt der Kanton allen Personen, welche ein Patent eines sogenannten Patentgewässers kaufen wollen, eine App zur Verfügung. Patentgewässer sind der Bodensee, der Alpenrhein, der Walensee und der Zürichsee. Für diese Gewässer verkauft der Kanton und ein paar Gemeinden die Wochen-, Monats- und Jahrespatente.
Ab 1. Januar 2026 können Fischerinnen und Fischer diese Patente neu direkt über eine App lösen und auch über diese App ihre Fischfänge erfassen. Im Dezember wird über die Homepage der Fischerei alles aufgeschaltet was man dazu wissen muss und wo man die App herunterladen kann. Auch viele Anleitungen und Hilfestellungen stehen dann zur Verfügung. Alle heutigen Besitzer und Besitzerinnen von Fischereipatenten werden zudem schriftlich informiert.
Wir freuen uns sehr, diesen Schritt mit allen Fischereibegeisterten zu gehen.
Neues Bewirtschaftsungskonzept
Das neue Bewirtschaftungskonzept Fischerei des Kantons St.Gallen (2025–2032) zeigt, wie eine moderne Fischerei aussieht, die Verantwortung für Natur und Nutzung vereint. Im Zentrum stehen drei gleichwertige Ziele: Lebensraumschutz, Artenschutz und nachhaltige Nutzung.
Das Konzept beschreibt, wie sich die Fischerei im Kanton weiterentwickelt – vom reinen Ertragsdenken hin zu einer ökologisch fundierten Bewirtschaftung. Es zeigt auf, wie revitalisierte Gewässer, autochthone Fischbestände und gezielte Schutzmassnahmen die Grundlage für stabile Fischpopulationen bilden. Auch Themen wie Klimawandel, Wasserkraft, Neozoen, Mikroverunreinigungen und die Zusammenarbeit mit Fischereivereinen, NGOs und Nachbarländern werden praxisnah behandelt.
Besonders spannend:
- Wie funktionieren autochthone Bewirtschaftung und Besatz nur dort, wo nötig?
- Welche Massnahmen schützen Forellen, Äschen oder Nasen konkret?
- Wie kann man Fischerei, Energiegewinnung und Naturschutz in Einklang bringen?
Das Konzept liefert Antworten auf diese Fragen – und schafft die Grundlage für eine zukunftsgerichtete Fischereipolitik, die Natur, Forschung und Menschen verbindet.
Lesenswert für alle, die sich für gesunde Gewässer, nachhaltige Nutzung und die Zukunft der Fischerei im Kanton St.Gallen interessieren.
-> Bewirtschaftungskonzept Fischerei Kanton St.Gallen neues Fenster
Herzlich Willkommen Dr. David Frei

Dr. David Frei tritt die Nachfolge von Michael Kugler als Fachspezialist Fischerei und Stellvertreter von Christoph Birrer an. David, der am Bodensee aufgewachsen ist und sich leidenschaftlich der Fischerei widmet, bringt umfangreiche wissenschaftliche Erfahrung mit. Mit einem Doktorat in Ökologie und Evolution und seiner Arbeit bei der Schweizerischen Fischereiberatungsstelle FIBER sowie dem Ökobüro Fornat AG, wird er die Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis weiter stärken. Michael Kugler geht Mitte 2026 in den wohlverdienten Ruhestand.
ABTEILUNG NATUR UND LANDSCHAFT

Revidierte Wegleitung zu Schutzverordnungen

Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei hat die Wegleitung zur Erstellung und Revision von Schutzverordnungen im Bereich Natur und Landschaft sowie das Musterreglement überarbeitet. Ziel ist es, wertvolle Landschaften und Lebensräume im Kanton langfristig zu erhalten und für diesen Prozess Gemeinden sowie Planungsbüros zu unterstützen. Mit dieser neuen Wegleitung können die Gemeinden die gesetzlichen Anforderungen an Schutzverordnungen künftig noch besser erfüllen und Klarheit für alle Beteiligten schaffen.
Die neue Wegleitung klärt unter anderem den Umgang mit neuen fachlichen Grundlagen (z.B. Biotopkartierungen neues Fenster), geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen (revidierte Jagdverordnung neues Fenster ) und klärt Fragen zur Vollzugspraxis (z.B. Bestimmungen zur Umgebung von Amphibienlaichgebieten neues Fenster). Die überarbeitete Wegleitung und das Musterreglement werden unter folgendem Link ab Ende November verfügbar sein.
Quell-Lebensräume

Quellen gehören zu den unscheinbarsten, aber auch zu den wertvollsten Lebensräumen im Kanton St.Gallen. Sie entstehen dort, wo Grundwasser an die Oberfläche tritt – oft abseits der grossen Gewässer, verborgen in Wäldern oder an Hängen. Trotz ihrer Kleinräumigkeit zeichnen sich Quellen durch eine aussergewöhnlich hohe ökologische Vielfalt aus.
In Quellen treffen aquatische und terrestrische Lebensräume auf engstem Raum zusammen. Diese Übergangsbereiche schaffen eine enorme strukturelle Vielfalt und bieten Lebensbedingungen für zahlreiche hoch spezialisierte, oft bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Das Wasser ist in der Regel nährstoffarm und konstant temperiert, was diese Lebensgemeinschaften besonders empfindlich gegenüber Veränderungen macht. Schon kleinste Eingriffe – etwa Drainagen, Fassung oder Bodenverdichtung – können eine Quelle nachhaltig schädigen oder zerstören.
Mit der Klimaveränderung steigt der Druck auf die Quell-Lebensräume zusätzlich. Längere Trockenphasen, veränderte Niederschlagsmuster und steigende Temperaturen gefährden die empfindlichen Quellökosysteme. Studien zeigen, dass in der Schweiz nur noch rund zehn Prozent der Quellen in einem natürlichen oder naturnahen Zustand sind – ein klarer Handlungsauftrag für den Naturschutz.
Um die Quellen gezielt zu erfassen und zu erhalten, führt das Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.Gallen derzeit eine systematische Erhebung ungefasster Quellen im gesamten Kantonsgebiet durch. Diese Erhebung basiert auf einer vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) entwickelten Bewertungsmethode, die eine einheitliche Erfassung und Bewertung der Quell-Lebensräume in der ganzen Schweiz ermöglicht.
Zudem hat die Beratungsstelle Quell-Lebensräume in Zusammenarbeit mit dem Kanton St.Gallen und weiteren Kantonen Leitlinien für den Schutz, die nachhaltige Nutzung und die ökologische Aufwertung von Quellen erarbeitet. Diese unterstützen die Kantone im Vollzug und helfen, die wertvollen Quell-Lebensräume langfristig zu sichern – als Hotspots der Biodiversität und als stille Zeugen einer intakten Natur.
KOM_Quell_Lebensräume im Vollzug_20250123_KommANJF_20250730 neues Fenster
Kopf und Zahl 2025

Die Fachstelle Statistik bietet mit der Publikation «Kopf und Zahl» einen statistischen Überblick mit aktuellen Kennzahlen zu wichtigen Themen im Kanton St.Gallen.
Die Ausgabe 2025 widmet dem Thema Biodiversität einen Spezialbeitrag. Darin enthalten ist eine Übersicht zu Aufwertungsmassnahmen in Biotopen von nationaler und regionaler Bedeutung und die Entwicklung der Flächen mit Naturschutzverträgen.
Kopf und Zahl 2025 | berichte.sg.ch neues Fenster
Umwelt Spezial: Biodiversität | berichte.sg.ch neues Fenster
ABTEILUNG JAGD

Luchsmonitoring Nordostschweiz 2024/25 - Anzahl Luchste stieg nicht weiter an

Zum sechsten Mal seit der Wiederansiedlung des Luchses in der Nordostschweiz wurde der Bestand der Grosskatze systematisch erhoben. Die Auswertung zeigt: Die Population hat sich stabilisiert. Die Luchsdichte beträgt rund 2.7 selbständige Tiere pro 100 km² geeigneten Lebensraums – ein im Vergleich zu anderen Referenzgebieten eher tiefer Wert. Trotzdem blieb der Bestand in den letzten Jahren insgesamt stabil.
Warum die Population nicht weiter wächst, kann verschiedene Gründe haben: Möglich ist, dass die Kapazität des Lebensraums erreicht ist, dass durch den Fang von Luchsen für Wiederansiedlungsprojekte in Deutschland der natürliche Zuwachs abgeschöpft wurde oder dass die neu entdeckte Genmutation das Populationswachstum beeinflusst.
Das Monitoring wird von der Koordinationsstelle für Raubtierökologie und Wildtiermanagement (KORA) in Zusammenarbeit mit den Kantonen, Wildhütern und Fachinstitutionen durchgeführt. Ziel ist es, die Entwicklung der Luchspopulationen langfristig zu dokumentieren, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und eine Grundlage für ein ausgewogenes Wildtiermanagement zu schaffen.
Die genetische Vielfalt der Luchspopulation in der Schweiz ist derzeit sehr gering. Eine geringe genetische Diversität kann die Population schwächen und die Ausbreitung von Krankheiten oder Gendefekten begünstigen. Deshalb wurde von Bund, Kantonen und Fachinstitutionen eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit der genetischen Sanierung der Luchspopulation befasst. Um die Situation zu verbessern, müssen die verschiedenen Luchspopulationen und Lebensräume besser vernetzt (Wildtierkorridore) und neue Gene in die Population eingebracht werden.
KORA-Bericht Luchs neues Fenster
Was fressen Wölfe in der Schweiz?

Eine neue genetische Studie von KORA zeigt: Wölfe ernähren sich in der Schweiz zu über 88 % von Wildtieren – vor allem von Rothirschen, Rehen und Gämsen. Nur rund 12 % der Nahrung stammen von Nutztieren, hauptsächlich von Schafen.
Die Untersuchung zeigt zudem regionale, soziale und saisonale Unterschiede im Fressverhalten: Einzelwölfe ernähren sich häufiger von Rehen, während Rudel vor allem Rothirsche reissen. Im Winter stehen vermehrt Rehe auf dem Speiseplan, während im Sommer Gämsen und Schafe häufiger gefressen werden.
Diese Ergebnisse geben spannende Einblicke in das ökologische Verhalten der Wölfe und helfen, ihr Zusammenleben mit Wild- und Nutztieren besser zu verstehen.
Mehr erfahren im Factsheet „Nahrungsanalyse Wolf neues Fenster
Gute Zwischenbilanz aus der Jagd

Die Hauptjagdzeit im Kanton St.Gallen dauert vom dritten Samstag im August bis zum dritten Samstag im Dezember. Bereits bis Mitte Oktober haben die Jägerinnen und Jäger eine beeindruckende Leistung erbracht.
Mit über 2'000 Rehen und rund 400 Gämsen liegen die Abschusszahlen im Durchschnitt der letzten Jahre. Hinzu kommen 55 Steinböcke und 53 Wildschweine. Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei der Rothirsch-Jagd: Mit knapp 500 erlegten Tieren liegen die Abschusszahlen erneut über dem Vorjahreswert. Diese Steigerung ist wichtig, um die kantonalen Abschussziele zu erreichen und den Bestand an Rothirschen langfristig zu reduzieren.
Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei dankt allen Jägerinnen und Jägern für ihren grossen Einsatz und wünscht weiterhin ein kräftiges Weidmannsheil!
Footer
Amt für Natur, Jagd und Fischerei
Davidstrasse 35
9001 St. Gallen