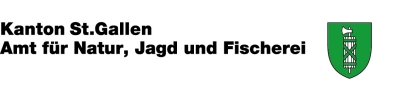Amt für Natur, Jagd und Fischerei
Neues aus unserem Amt
Newsletter ANJF 2025-01
 Robert Han.jpg)
Die Natur und Fischerei im Kanton St.Gallen stehen im Fokus aktueller Entwicklungen. Neue Schutzmassnahmen sollen den Äschenbestand im Linthkanal stabilisieren, während die Vergabe der Pachtgewässer für die Periode 2025–2032 erfolgreich abgeschlossen wurde. Auch im Bereich der Neobiota gibt es Veränderungen: Das ANJF übernimmt neu die Koordination zur Bekämpfung invasiver Arten. Gleichzeitig schreiten die Sanierungen und Aufwertungen von Biotopen voran – bereits in 120 Schutzgebieten konnten Verbesserungen umgesetzt werden. Erfahren Sie mehr über aktuelle Herausforderungen, Erfolge und geplante Massnahmen in unserem Newsletter!
ABTEILUNG JAGD
Vorschau Hegeschau und Zahlen Rothirschjagd 2024
.jpg)
Am Abend des 7. März 2025 findet in Walenstadt die kantonale Rothirsch- und Gamshegeschau statt. Wir laden Sie herzlich ein, an diesem Anlass teilzunehmen.
Die Hegeschau bietet eine wertvolle Gelegenheit, gemeinsam auf die Herausforderungen und Erfolge des vergangenen Jagdjahres zurückzublicken. Sie präsentiert nicht nur die Vielfalt der Gams- und Hirschtrophäen, sondern unterstreicht auch die Bedeutung eines fachkundigen und nachhaltigen Wildtiermanagements.
Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen, Fachwissen auszutauschen und sich über aktuelle Entwicklungen in Jagd und Naturschutz zu informieren.
Erfolgreiche Rothirschjagd 2024
Der Rückblick auf die Rothirschjagd 2024 fällt sehr erfreulich aus:
Insgesamt wurden 385 Kälber sowie 366 Kühe und Schmaltiere erlegt. Nach mehreren Jahren gezielter Zurückhaltung zur Korrektur des Geschlechtsverhältnisses konnten nun auch wieder mehr Stiere freigegeben werden. Mit 193 erlegten Stieren wurde ein neuer Rekord erreicht.
Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) dankt allen Jägerinnen und Jägern für ihren grossartigen und unermüdlichen Einsatz zur Erreichung der strategischen Jagdziele.
.jpg)
Morgen- oder Abendansitz – was ist erfolgreicher?
Um erfolgreich zu jagen, muss die Jagdstrategie stets überdacht und an Wetter, Jahreszeit und Wildverhalten angepasst werden.
Im Jahr 2024 wurden rund ein Viertel der auf Ansitz oder Pirsch erlegten Rothirsche in den Morgenstunden gestreckt, während etwa drei Viertel am Abend zur Strecke kamen. Doch ist die Abendjagd tatsächlich erfolgreicher – oder wird sie einfach häufiger ausgeübt, während der Morgenansitz unterschätzt wird?
Der besondere Reiz des Morgenansitzes
Der Morgenansitz hat aus verschiedenen Gründen seinen eigenen Reiz. Das Erwachen der Natur zu erleben, ist unabhängig vom jagdlichen Erfolg ein Genuss. Wenn sich der Wald langsam mit Leben füllt, gehört ein ganz besonderer Frühaufsteher dazu: das Rotkehlchen.
Dieser weit verbreitete Wald- und Siedlungsvogel ist oft einer der ersten Singvögel, die mit ihrem Gesang die Dämmerung einläuten. Passend dazu wurde das Rotkehlchen zum Vogel des Jahres 2025 gewählt. Es steht als Symbol für struktur- und abwechslungsreiche Lebensräume mit Sträuchern und Hecken – ein wichtiger Appell für mehr Naturschutz.
Neues eidgenössisches Jagdrecht
Ab dem 1. Februar 2025 ist das neue eidgenössische Jagdrecht in Kraft. Neben der Streichung des Schalldämpfers als jagdlich verbotenes Hilfsmittel ändern auch noch verschiedene weitere Punkte in Bezug auf die Jagd, aber auch das Management von Bibern und Wölfen, den Herdenschutz oder den Schutz der Wildtierkorridore. In einem kurzen Überblick haben wir die wichtigsten Änderungen zusammengestellt.
ABTEILUNG NATUR UND LANDSCHAFT
Fortschritte bei den Biotopsanierungen
.jpg)
Der Kanton St.Gallen hat sich im Rahmen der kantonalen Biodiversitätsstrategie 2018-2025 neues Fenster zum Ziel gesetzt, den aktuellen Zustand der Biotope von nationaler und regionaler Bedeutung zu erfassen und den daraus abgeleiteten Handlungsbedarf gezielt anzugehen.
Die Zustandserfassung hat ergeben, dass bei etwa 500 der 900 Schutzgebieten von nationaler und regionaler Bedeutung Handlungsbedarf besteht. In etwa einem Drittel der Fälle konnte durch eine gezielte Bewirtschaftungsanpassung die Situation mittlerweile erheblich verbessert werden. Bei den restlichen zwei Dritteln sind umfangreichere Massnahmen erforderlich. Typische Massnahmen sind das Ausbaggern von verlandeten Amphibienlaichgewässern, die Wiederherstellung des Wasserhaushalts durch Setzen von Spundwänden in Hochmooren oder das Ausholzen oder Auflichten von verbuschten Trockenwiesen und Flachmooren.
Mittlerweile konnten in 120 Schutzgebieten Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen umgesetzt werden, womit der jeweilige Handlungsbedarf vollständig oder zumindest teilweise behoben werden konnte. Für mindestens doppelt so viele Schutzgebiete sind Sanierungen in Planung oder bereits in Umsetzung. 2024 konnten umfangreiche Sanierungen in den Amphibienlaichgebieten «Schuppis» in Goldach, «Eselschwanz» in St. Margrethen, «Höchstern» in Balgach/Widnau, «Arniger Witi» in Gossau, «Feerbach» in Vilters-Wangs, in den Flachmooren «Joner Wald» in Rapperswil-Jona, «Zuzwiler Riet» in Zuzwil und im «Benkner-, Burger- und Kaltbrunner Riet», im TWW «Chürschnen» in Mels und in den Thurauen abgeschlossen werden. Die Projekte wurden in Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Kanton und weiteren Akteuren wie Schutzorganisationen, Forstdiensten und Ortsgemeinden geplant und umgesetzt.
Wir freuen uns sehr, dass in den vergangenen Jahren sehr viele Schutzgebiete von umfassenden Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen profitieren konnten und dass zusammen mit engagierten Gemeinden, Naturschutzorganisationen oder Privaten in den nächsten Jahren weitere Projekte angegangen werden. Es gibt noch viel zu tun!
Kurs "Naturnahe Wiesenpflege im Siedlungsraum"
.png)
Im Auftrag des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei führt PUSCH neues Fenster 2025 erneut einen interessanten Weiterbildungskurs zum Thema Biodiversitätsförderung im Siedlungsraum durch. Der Kurs ist auf die Ziele der Biodiversitätsstrategie des Kantons St.Gallen abgestimmt und Werkhofmitarbeitende aus St.Galler Gemeinden können zu stark vergünstigten Konditionen teilnehmen.
23. Mai 2025 l Tageskurs l St. Gallen
Naturnahe Wiesenpflege im Siedlungsraum
Attraktive, naturnahe Grünflächen wirken sich positiv auf die Lebensqualität und den Erhalt der Biodiversität aus. Lernen Sie den Pflegebedarf verschiedener Wiesen und Blumenrasen kennen und wie Sie die Pflege naturnah und effizient ausführen können. Erfahren Sie anhand konkreter Beispiele vor Ort, was es beim Anlegen neuer Blumenwiesen zu beachten gilt und welches Werkzeug sich besonders eignet, um ökologisch und ästhetisch überzeugende Ergebnisse zu erzielen.
https://www.pusch.ch/umweltagenda/wiesenpflege-im-siedlungsraum neues Fenster
Neue Fachstelle für invasive Neobiota
Der Kanton St. Gallen ist verpflichtet, Massnahmen zum Umgang mit invasiven Organismen zu ergreifen, die Menschen, Tiere, die Umwelt oder die biologische Vielfalt schädigen können. Bisher wurde die Bekämpfung verbotener invasiver Neophyten vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) koordiniert, während das Amt für Umwelt (AFU) für nicht verbotene Arten zuständig war. Diese geteilte Zuständigkeit führte jedoch zu Unklarheiten und einem ineffizienten Vollzug. Zudem fehlten dem AFU die nötigen Ressourcen, um die Freisetzungsverordnung konsequent durchzusetzen. Das ANJF hingegen hat in den vergangenen Jahren umfangreiches Fachwissen und Erfahrung im Umgang mit invasiven Arten aufgebaut.
Deshalb hat die Regierung entschieden, die Koordination im Bereich Neobiota vollständig dem ANJF zu übertragen.
Adrian Weidmann – Fachspezialist für invasive Neobiota
Seit Dezember 2024 verstärkt Adrian Weidmann das ANJF als Fachspezialist für Koordination und Strategieplanung im Bereich invasive Neobiota. Er ist die zentrale Anlaufstelle für den Kanton, Gemeinden, Fachunternehmen und die Bevölkerung und vertritt das ANJF im interkantonalen Austausch zu gebietsfremden Organismen (Cercle exotique).
Auf ihn warten spannende und herausfordernde Aufgaben:
- Verhinderung der rasanten Ausbreitung der invasiven Quagga-Muschel,
- Überwachung neuer Populationen der Asiatischen Hornisse,
- Massnahmen gegen die krankheitsübertragende Tigermücke.
Zusätzlich koordiniert er die Erweiterung der bisherigen Neophyten-Strategie hin zu einer umfassenden Neobiota-Strategie und organisiert Marktkontrollen sowie Sensibilisierungs- und Kommunikationsmassnahmen.
Ein Biologe mit Leidenschaft für die Natur
Nach seiner Lehre als Polymechaniker und fast sechsjähriger Tätigkeit als Maschinenmechaniker entschied sich Adrian, seiner Leidenschaft für die Natur zu folgen. Er studierte Biologie an der Universität Zürich und spezialisierte sich in seinem Master in Ökologie auf die negativen Auswirkungen invasiver Tierarten auf einheimische Ökosysteme.
In seiner Forschung untersuchte er unter anderem:
- Den Einfluss der aus Südostasien stammenden Kirschessigfliege auf das Nahrungsvorkommen einheimischer Kleinsäuger und Vögel,
- Die reduzierte Samenverbreitung früchtetragender Pflanzen durch die veränderte Nahrungsverfügbarkeit.
Naturverbunden und engagiert
In seiner Freizeit ist Adrian meist mit Kamera und Feldstecher in der Natur unterwegs, geht mit der Angelrute an die Thur oder begleitet seinen Vater auf die Jagd. Zudem engagiert er sich als Vorstandsmitglied des Natur- und Vogelschutzvereins Altikon. Dort organisiert und leitet er Exkursionen, um die Bevölkerung für Ringelnatter, Flussregenpfeifer & Co. zu sensibilisieren.
ABTEILUNG FISCHEREI
Anpassungen Ausführungsbestimmungen Linthkanal
.jpg)
Der Äschenbestand im Linthkanal ist in einem kritischen Zustand. Nach jahrzehntelangem Fangrückgang und den historisch tiefen Zahlen im Jahr 2023 – lediglich 60 Äschen mit einem Gesamtgewicht von 28.8 kg – hat die Fischereikommission für den Zürichsee, den Linthkanal und den Walensee an ihrer Sitzung vom 13. Juni 2024 weitreichende Massnahmen beschlossen.
Neben gezielten Lebensraumverbesserungen wie Kiesschüttungen und der verstärkten Bejagung des Kormorans wurden auch einschneidende Verschärfungen in der Fischerei beschlossen. Weiter werden verschiedene Lebensraumaufwertungen in diesem Frühling ausgeführt.
Neue Fischereiregeln ab dem 1. Januar 2025
Die überarbeiteten «Ausführungsbestimmungen über die Fischerei im Linthkanal» (sGS 854.351.2) bringen ab 1. Januar 2025 folgende Änderungen:
- Nur noch ein Köder zulässig, der am Ende der Montage befestigt sein muss.
- Tagesfangbegrenzung: Maximal eine Forelle und eine Äsche pro Tag.
- Drei Jahre lang ein grosses Schongebiet:
- Vom Ausfluss des Walensees bis zur Strassenbrücke Giessenstrasse bei Benken gilt ein ganzjähriges Fischereiverbot.
- Dies betrifft rund zwei Drittel des gesamten Linthkanals.
- Die Regelung gilt vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2027.
Die Veröffentlichung dieses Beschlusses erfolgte im Dezember 2024 auf den Publikationsplattformen der Kantone St.Gallen, Glarus und Schwyz.
Begleitendes Monitoring 2025–2027
Um die Auswirkungen dieser Schonbestimmungen auf den Äschenbestand im Linthkanal zu analysieren, werden zwischen 2025 und 2027 verschiedene wissenschaftliche Monitorings durchgeführt:
- Erhebung der Fangstatistiken, inkl. Aufwandsanalysen.
- Enge Zusammenarbeit mit Angelfischern im Rahmen einer Sonderfischerei:
- Speziell nominierte Angelfischer sind im Auftrag der Fischereibehörde am Linthkanal unterwegs.
- Sie fangen und beproben Äschen und Forellen, um Daten zu Wachstum, Alter, Geschlechtsreife und weiteren relevanten Faktoren zu sammeln.
Diese Erkenntnisse sind entscheidend für eine angepasste Bewirtschaftung und zukünftige Schonbestimmungen.
Vergabe der Pachtgewässer für die Periode 2025-2032
.jpg)
In der zweiten Jahreshälfte 2024 wurden die rund 200 Pachtgewässer für die kommende achtjährige Pachtperiode (1. Januar 2025 – 31. Dezember 2032) ausgeschrieben und neu vergeben.
Erstmals erfolgte die Ausschreibung und die anschliessende Bewerbung der Interessenten digital.
Reibungslose Neuvergabe mit grossem administrativem Aufwand
Die Neuvergabe der Fischerpachtgewässer war mit erheblichem administrativem Aufwand verbunden, verlief jedoch gut und ohne grössere Streitigkeiten. Per Ende Dezember 2024 waren insgesamt 202 Reviere verpachtet – mit einer Gesamtpachtsumme von rund CHF 340'000.
In einigen Fällen gab es Doppel- oder sogar Dreifachbewerbungen, die jedoch fast ausnahmslos einvernehmlich geregelt werden konnten.
Bei den Pachtgebieten der Fischereivereine gab es nur kleine Änderungen – die Mehrheit der Vereine behalten die gleichen Gewässer, die sie bereits in der vorherigen Pachtperiode (2016–2024) bewirtschaftet haben.
Unverpachtete Reviere: Kleine oder problematische Gewässer
Ende 2024 blieben etwas mehr als 20 Reviere unverpachtet. Dies ist nachvollziehbar, da es sich dabei entweder um sehr kleine Bäche oder um Problemgewässer handelt, in denen eine nachhaltige Fischerei aus verschiedenen Gründen kaum möglich ist – sei es aufgrund von Trockheitsproblemen, schwieriger Topografie oder anderen ungünstigen Faktoren.
Footer
Amt für Natur, Jagd und Fischerei
Davidstrasse 35
9001 St. Gallen